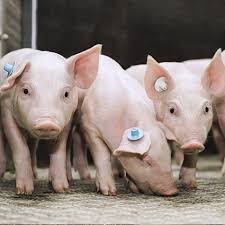Xaletto ist ein Strohhaltungssystem für Warmställe. Vorteile: Es fällt keine Gülle an, es riecht kaum und es bietet viel Tierwohl.
Ein Warmstall mit Stroheinstreu – das klingt zunächst nicht nach emissionsarmer, innovativer Stalltechnik, doch das Xaletto-Stallsystem hat es in sich. Es verspricht ein hohes Maß anTierwohl, Stroheinstreu und gegenüber vergleichbaren Stallsystemen in der Schweinehaltung deutlich geringere Emissionen.
Die Basis des Verfahrens sind eine spezielle Lüftung, eine auf das System abgestimmte Fütterung und ein Rotteaktivator, der dem Stroh schon frühzeitig hinzugeführt wird. Xaletto steht im Italienischen – etwas frei übersetzt – für „ins Bett bringen“ und darum geht es auch bei diesem gleichnamigen Stallkonzept für Aufzuchtferkel und Mastschweine: Die Schweine liegen auf einer wohligen und trockenen Strohmatratze.
Die Luft im wärmegedämmten Stall ist angenehm. Der typische Schweinegeruch, wie er in manchen Warmställen noch herrscht, ist hier nicht wahrnehmbar. Das liegt vor allem daran, dass in diesem Haltungssystem keine Gülle anfällt und es ohne Spaltenboden auskommt. Dem Strohbett im Stall wird zudem permanent Feuchte entzogen wird. Das mindert Emissionen und fördert den Umweltschutz.
Die Idee für die Haltungsform stammt aus der Praxis, von einem niedersächsischen Schweinehalter. Der Stallausrüster BigDutchman und der Mischfutterhersteller Bröring griffen es auf und entwickelten es weiter. Das Ergebnis sind wirtschaftliche Schweinemastställe mit Stroheinstreu, die eine Schweinehaltung ermöglicht, die das natürliche Verhalten der Schweine fördert und mit dem Umweltschutz vereinbar ist.
Das Konzept eignet sich für Neu- und Umbauten und ist vor allem auch in den Regionen interessant, in denen Gülle ein begrenzender Produktionsfaktor ist. Das Konzept kann sowohl in bestehenden Ställen als auch bei Neu- und Umbauten umgesetzt werden. Zudem eignet es sich für verschiedene Gruppengrößen in der Ferkelaufzucht und Mast.
Die Buchtenstrukturierung ermöglicht es den Schweinen das Platzangebot optimal zu nutzen. Das Xaletto-Haltungssystem bestehen aus zwei planbefestigten Flächen. Direkt am Zentralgang befindet sich ein erhöhter Sockel, auf dem Trockenfutterautomaten und eine offene Tränke mit Aqualevel installiert sind.
An den Sockel schließt sich der Liegebereich mit Tiefstreu an. Der frühzeitig hinzugegebene Bioaktivator sorgt dafür, dass bereits in frühen Phasen der Ferkelaufzucht oder Mast ein Rotteprozess statt einer Fäulnis einsetzt. Der gesamte Mist ist damit kompostierbar und die Nährstoffe sind in diesem Endprodukt organisch gebunden. Außerdem sind die Emissionen deutlich geringer als bei konventionellen Haltungsverfahren.
Die Kombination aus angepasster Fütterung, Strohmanagement und Klimaführung sorgt zudem dafür, dass dem Strohbett permanent Flüssigkeit entzogen wird. Das fördert die Zersetzung, wobei aerobe Bakterien den Mist abbauen. Diese sogenannte Kaltrotte läuft in der Mistmatratze bei etwa 40 °C ab und wird durch den speziellen Bioaktivator in Gang gesetzt.
Das in der Mistmatratze enthaltene Wasser verdunstet dabei. Stickstoff und Ammoniak werden auswaschbar gebunden, ohne zu emittieren. Das Strohbett bleibt so während des Durchgangs sehr flach und es kann Einstreumaterial gespart werden. Außerdem sorgt das verdunstende Wasser dafür, dass die Oberfläche der Mistmatratze für die Schweine angenehm kühl bleibt.
Die spezielle Technik im Stall sorgt dafür, dass aus der Mistmatratze stets Feuchtigkeit und Schadgase aus dem Stall entfernt werden. Die Lüftung erfolgt über Wandventile, die in erster Linie über die Luftfeuchte gesteuert werden und jederzeit für ausreichend Frischluft sorgen. Seit Kurzem kann die Abluft des Stalls mithilfe eines Abluftwäschers gereinigt werden. Der PURO-X ist ein speziell für Strohställe entwickelter, zweistufiger, chemisch arbeitender Abluftwäscher, der die Stallluft von Staub, Ammoniak und Geruchsstoffen befreit. Der Abluftwäscher ist DLG-zertifiziert und in einer modularen Bauweise erhältlich.
Damit sind die Montagezeiten gut planbar und die Baukosten sowie der Aufwand für die Installation bleiben gering. Das aus einem Guss bestehende Kunststoffgehäuse sorgt zuverlässig und langfristig für hohe Dichtigkeit. Das Material ist besonders beständig gegenüber Säuren, Laugen und dem Prozesswasser.
Auch ohne den Einsatz eines Abluftwäschers sind die Emissionen im Xaletto-Strohstallsystem deutlich geringer als in vergleichbaren Stallsystemen. Das haben Emissionsmessungen der LUFA Nord-West im niedersächsischen Xaletto-Praxisbetrieb gezeigt. Dabei wurden in sieben Zeiträumen im Jahr 2020 Messungen, sowohl in der ersten als auch zweiten Produktionshälfte, durchgeführt. Anschließend wurden Mittelwerte aus den Messungen gebildet und mit dem an die stickstoff- und phosphorreduzierte Fütterung angepassten Ammoniakreferenzwert verglichen. Er liegt bei 3,89 kg. Aus den Messungen im Praxisbetrieb ergab sich ein mittlerer Ammoniakemissionswert von 3,12 kg. Er liegt damit 20 Prozent unter dem Referenzwert für vergleichbare Stallsysteme mit ähnlicher nährstoffreduzierter Fütterung. Damit fördert die Haltung nicht nur das natürliche Verhalten der Schweine, sondern auch ihre Gesundheit.
Mehr Arbeit fällt trotz der Stroheinstreu für den Landwirt jedoch nicht an. Der Stalleinrichter bietet einen auf die Xaletto-Schweinehaltung abgestimmten Einstreuroboter an. Damit können das Strohmanagement verbessert und die Strohverluste reduziert werden. Praxisversuche zeigen, dass so etwa 20 Prozent Stroh im Vergleich zu den aktuellen Empfehlungen der KTBL eingespart werden können. Den Schweinen bietet die Stroheinstreu ein natürliches Wühlmaterial, das stets zur Beschäftigung einlädt.