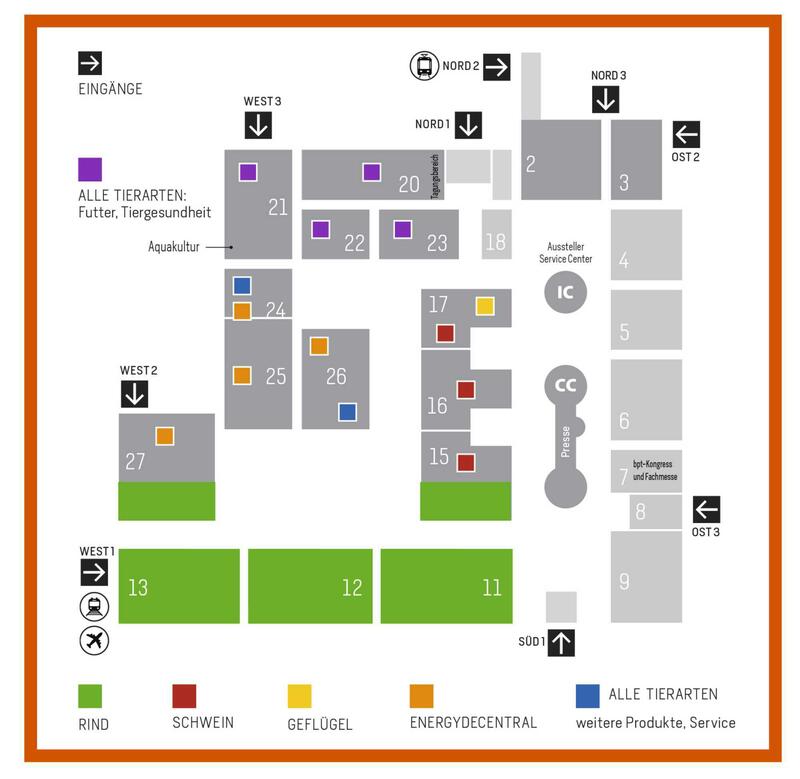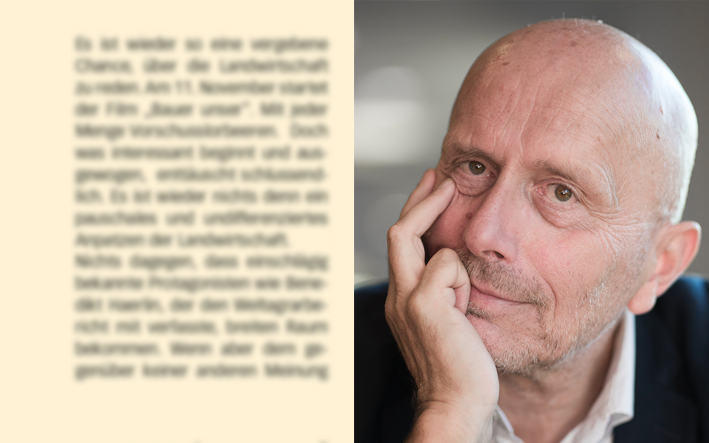Noch nie wurde soviel Weizen weltweit gehandelt
Neuer Rekord beim Weizenhandel: Vor allem die Ausfuhren Australiens, Kasachstans und aus GB dürften höher ausfallen und den prognostizierten Rückgang der argentinischen Ausfuhren mehr als ausgleichen.
Der internationale Handel mit Weizen dürfte im laufenden Vermarktungsjahr 2022/23 trotz der relativ hohen Preise so umfangreich wie noch nie ausfallen. Das amerikanische Landwirtschaftsministerium (USDA) geht in seinem aktuellen Bericht von einer Handelsrekordmenge von 208,7 Mio. t Weizen aus.
Im Oktober waren noch 300.000 t weniger erwartet worden. Für 2021/22 wird die international gehandelte Weizenmenge auf 202,8 Mio. t veranschlagt.
Vor allem die Weizenausfuhren Australiens, Kasachstans und des Vereinigten Königreichs dürften nach Einschätzung der Washingtoner Beamten höher ausfallen als bislang erwartet und den prognostizierten Rückgang der argentinischen Ausfuhren mehr als ausgleichen.
Die Weizenexporte der Ukraine und Russlands sehen die Fachleute im laufenden Wirtschaftsjahr unverändert bei 11 Mio. t und 42 Mio. t; das wären 7,8 Mio. t weniger beziehungsweise 9 Mio. t mehr als 2021/22.
Das Welthandelsvolumen an Mais veranschlagt das USDA für 2022/23 jetzt auf 183,5 Mio. t. Das entspricht gegenüber der vorherigen Prognose einem Abschlag von 1,3 Mio. t Mais wegen voraussichtlich geringerer Exporte argentinischer und südafrikanischer Ware. Der internationale Maishandel im vergangenen Wirtschaftsjahr belief sich noch auf schätzungsweise 193 Mio. t.
Wie beim Weizen beließen die Washingtoner Beamten auch beim Mais ihre Exportprognose für die Ukraine hinsichtlich der aktuellen Vermarktungssaison unverändert, nämlich bei 15,5 Mio. t. In der vergangenen Kampagne hatte das kriegsgeschüttelte Land noch 27 Mio. t Mais ins Ausland verkauft.
Die Getreidefutures an der Pariser Börse reagierten kaum auf die neuen USDA-Daten. Der vordere Matif-Weizenkontrakt mit Fälligkeit im Dezember 2022 kostete heute gegen 13.30 Uhr 331 €/t; das war nur 1 €/t mehr als der Eröffnungskurs von gestern, also vor der Veröffentlichung des USDA-Berichts. Gleichzeitig gab der Maisfuture zur Lieferung im März 2023 um 2,75 €/t auf 323,25 €/t nach. Agra Europe (AgE)